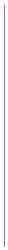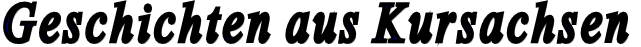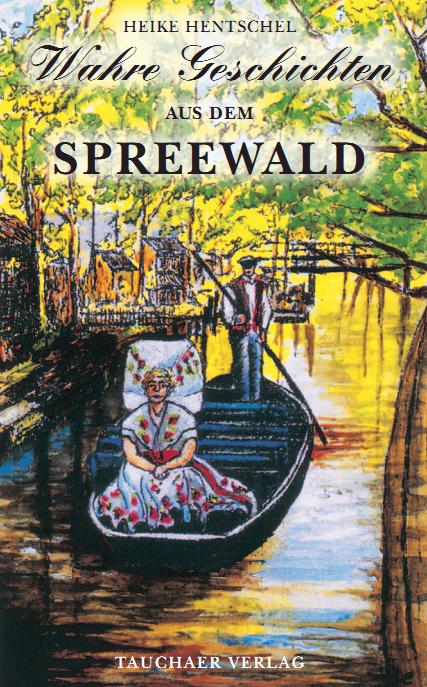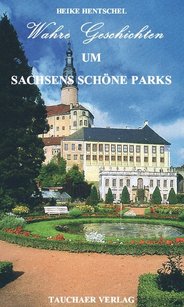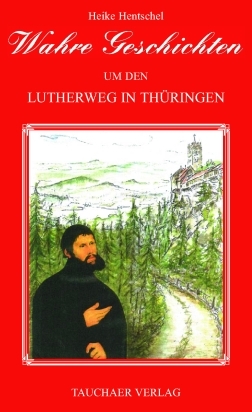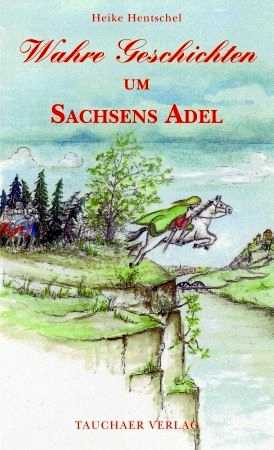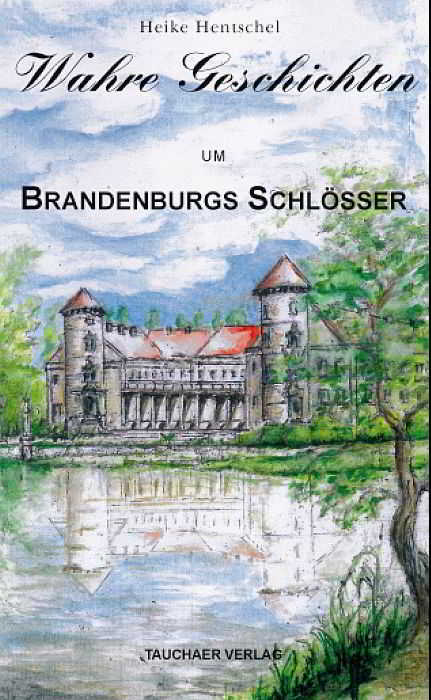Und daß dem Netze dieser Spreekanäle
Nichts von dem Zauber von Venedig fehle,
Durchfurcht das endlos wirre Flußrevier
In seinem Boot der Spreewalds-Gondolier.
Im Sommer 1859 war er von seinem Wohnort Berlin mit dem Nachtzug nach Lübben gereist, um, unter anderem bei einer Kahnfahrt, die Reize des Spreewaldes zu erfahren. Und natürlich verarbeitete der Schriftsteller das Erlebte sofort literarisch: Seine Reisebeschreibung erschien zunächst in der „Preußischen Zeitung“. 1882 arbeitete er den Text in den vierten Band der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ein, der den Titel „Spreeland“ trägt.
Bis heute sind die „Wanderungen“ populär und inspirieren zum Reisen auf Fontanes Spuren.
Diesen Vers stellte Theodor Fontane (1819 - 1898) seinem Reisebericht voran, der den Titel
„In den Spreewald“
trägt
Aber auch ein heute weniger bekannter Autor war zu seinen Lebzeiten und in seiner Region ein sehr produktiver und beliebter Reiseschriftsteller. Der Sachse Otto Eduard Schmidt (1855 - 1945) durchwanderte seine Heimat und verfasste Berichte über seine Erlebnisse, ähnlich wie Fontane Jahrzehnte vor ihm.
Allerdings bediente er sich eines kleinen Tricks. Das Königreich Sachsen war, Dank wiederholter Allianzen mit den „falschen“, nämlich den verlierenden Verbündeten, immer wieder gezwungen gewesen, Land abzutreten und war nach und nach immer kleiner geworden. Als der erste Band seiner Wanderungen 1902 erschien, trug er den Titel „Kursächsische Streifzüge“ - damit hatte Schmidt „seinen“ geografischen Raum geschickt ausgeweitet!
1904 erschien der zweite Band mit dem Titel „Wanderungen in der Ober- und Unterlausitz“. So wollen wir uns, unbesehen, ob dieser nun sächsisch oder preußisch war und heute brandenburgisch ist, mit Otto Eduard Schmidt von Sachsen aus auf in den Spreewald machen!
Theodor Fontane
Spreewaldlandschaft
Statt die Bahnverbindung zu nutzen, will Schmidt sich dem Spreewald „ganz allmählich“ nähern. Von Altdöbern geht es Richtung Vetschau / Wetošow. Einen ersten Zwischenstop legt er in Ogrosen / Hogrozna ein, weil ihn das Ensemble des „altertümlichen Kirchleins“ und der davor stehenden „Linde von ungewöhnlicher Größe und Schönheit“ so fasziniert, dass er und sein Begleiter spontan „von den Rädern sprangen“.
Also war Herr Schmidt vor über hundert Jahren mit einem Fortbewegungsmittel unterwegs, das heute bei sportlichen und umweltbewussten Feriengästen wieder voll im Trend liegt - dem Fahrrad! Und der Spreewald bietet sich für einen Fahrradurlaub geradezu an: Der eigens angelegte „Gurkenradweg“ führt über eine Gesamtlänge von 250 Kilometern einmal rund um und durch den ganzen Spreewald, er berührt viele Orte und ist - da es kaum Steigungen gibt - relativ leicht zu bewältigen. Folgen Sie einfach dem Logo der Rad fahrenden Gurke!
Buchtitel und Illustration
Auf dem Weg fallen Schmidt „die aufgeschlitzten Bäume“ auf, gemeint dürften hauptsächlich Weiden sein. Diese in der Mitte gespaltenen Bäume sind zwar typisch für den Spreewald, aber keineswegs eine regionale Laune der Natur, denn sie wurden mutwillig durchlöchert! Allerdings nicht, um dem Baum zu schaden, sondern um einem kleinen Kind zu helfen.
Wenn Eltern feststellen mussten, dass eines ihrer Kinder schwach und kränklich war, suchten sie einen jungen Weidenbaum, dessen Stamm sie mit einer Axt längs spalteten. Durch diesen Spalt steckte die Mutter ihr Kind, während der Vater den Baum auseinander zog, wobei er sorgfältig darauf achtete, dass die Krone unversehrt blieb. Schmidt schreibt als Erklärung: „Man denkt sich den Baum beseelt und meint nun, daß er seine gesunde Lebenskraft bei der Zeremonie mit der kranken des Kindes vertausche.“ Doch damit nicht genug, es gilt nun das Bäumchen weiterhin zu beobachten, denn: „der aufgeschlitzte Baum dient auch als Orakel. Geht er ein, so ist das ein schlimmes Zeichen für die Lebensdauer des durchgesteckten Kindes. Wächst er trotz der schweren Verwundung weiter, so hat auch das Kind ein langes Leben.“
Zum Abschluss soll, nachdem sächsische und preußische Schriftsteller zitiert worden sind, ein norddeutscher Dichter zu Wort kommen. 1875 veröffentlicht der in Husum geborene Theodor Storm (1817 - 1888) seine Novelle „Psyche“.
Der Hauptdarsteller, ein in Berlin lebender jungen Bildhauer, weiß nicht, wie er mit seiner unerklärten Liebe zu einer jungen Frau umgehen soll, und denkt irgendwann an den Rückzug in eine vergangene Idylle - in den Spreewald:
„Soviel stand fest, er wollte fort; er hatte das Bedürfnis, ganz mit sich allein zu sein; kein Sohn einer Mutter, kein Freund eines Freundes. Er dachte an den Spreewald mit seinem Netz von hundert stillen Wasserarmen, in dessen Schatten er sich einmal mit seinem Freunde, dem Maler, einen schönen Sommermonat lang verloren hatte. Auf einsamem Nachen unter überhängenden Erlen hinzufahren, zwischen flüsterndem Schilfrohr oder durch die breiten schwimmenden Blätter der Wasserlilie - wie erquickende Kühle wehte es ihn an. Er ging rascher unter den bestaubten Linden der Hauptstadt dahin; er konnte morgen, ja schon heute abreisen.“


Gleich im nächsten Dorf legt Schmidt wieder Halt ein, denn hier in Gahlen / Golyn gibt es eine Kirche, die sein Interesse weckt: „Auch die Kirche des benachbarten Dorfes Gahlen soll eine Erinnerung aus heidnischer Zeit bewahren. Es ist nämlich an der Außenwand ein aus schwarzem Stein gehauener Kopf eingemauert. Möglicherweise ist er der Rest eines slawischen Götzenbildes.“
Ob es sich wirklich um ein derartiges Götzenbild handelt, wird sich schlussendlich nicht mehr genau feststellen lassen. Es ist nicht einmal sicher, ob es aus der Entstehungszeit der Kirche - die auf die Mitte des 13. Jahrhunderts geschätzt wird - stammt. Denn der reliefartige Stein ist in einem erst Jahrhunderte später zugemauerten schmalen romanischen Fenster einfach zwischen die Feldsteine gesetzt worden, die zum Verfüllen dienten. Zu sehen ist der Stein noch heute - möge sich jeder selbst seine Meinung bilden!
In Vetschau angekommen findet Schmidt in der ganzen Stadt ein buntes Treiben vor, gerade wird „einer der berühmten Viehmärkte abgehalten […], auf denen die Bedeutung der Stadt teilweise beruht.“ Als echter Tourist erfreut er sich an dem „Getümmel der Spreewaldbauern und der in ihrer bunten Tracht erschienenen Bäuerinnen, die mit kundigem Griffe die Wampe einer Kuh oder eines Öchsleins erfühlten. Herrlich anzusehen war besonders eine stattliche Vierzigerin in rotem Rock, schwarzem Sammetmieder und blauseidenem, bis auf die Achseln reichenden, weit vom Haar abstehenden Kopfschmuck, der in schweren goldenen Fransen endete.“
Ein derart buntes Marktbild wird sich dem heutigen Besucher nicht mehr in der gleichen Form bieten, doch auch jetzt laden alljährlich verschiedene „Outdoor-Events“, vom Frühlingsfest über das sommerliche Stadtfest bis zum Weihnachtsmarkt, zum Schauen und Feiern ein.
Und nach dem Spaziergang durch die historische Altstadt mit ihren Besonderheiten, wie zum Beispiel dem ursprünglich im Stil der Renaissance erbauten Wasserschloss, oder der wendisch-deutschen Doppelkirche - ein Unikat! -gibt es heute Dinge zu sehen, die zu Zeiten Otto Eduard Schmidts noch gar nicht existierten!

Doppelkirche in Vetschau
Naturliebhaber können sich im vom NABU betriebenen Storchenzentrum über das Leben der hier alljährlich zahlreich aus Afrika eintreffenden Weißstörche informieren - im Freigelände gibt es neben praktischen Informationen natürlich ein Storchennest zu sehen.
Der aus einem märkischen Adelsgeschlecht stammende Landschaftsmaler und Volkskundler Wilibald von Schulenburg (1847 - 1934) lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für einige Jahre in Burg und sammelte in dieser Zeit alles, was ihm an Sagen, Bräuchen und Sitten erzählt wurde. In seinem 1880 erschienenen Buch “Wendische Volkssagen und Gebräuche aus dem Spreewald“ geht er auch auf den Storch ein, der eine besondere prophetische Bedeutung für die Bewohner des Spreewaldes hat:
„Wenn der Storch auf dem Dache sitzt, schlägt das Gewitter nicht ein. Wenn aber der Blitz einschlägt, wirft er seine Jungen zuvor herunter und schleppt Wasser mit dem Schnabel in das Nest.
Wenn er sein Nest verläßt, oder Eier oder Junge herunterwirft, kommt Feuer aus und das Haus verbrennt oder es kommen große Schloßen oder geschieht sonst ein Unglück.
Wo er auf dem Neste bleibt, brennt auch das Haus nicht ab, und wenn Feuer an einem Ende des Dorfes auskommen soll, bauen die Störche am anderen Ende ihre Nester, denn sie wissen ihr Unglück vorher und bleiben weg wo es kommt.
Der Storch ist der klügste von allem Federvieh, wenn er seine Zunge länger hätte, würde er sprechen können, er soll aber eine ganz kurze Zunge haben.
Wenn er wegzieht, trägt er die Vesper mit sich fort.
Wenn man im Frühjahre das erste mal den Storch fliegen sieht, soll man sich wälzen, dann bekommt man keine Kreuzschmerzen, ist flink und gesund das ganze Jahr; wenn man ihn stehen sieht, steht man auch, ist steif auf den Beinen, faul oder krank.“

Federzeichnung von A. Dürer
Wilibald von Schulenburg
1837 - 1934
Ein Abstecher von knapp 20 Kilometern in Richtung Nordost bringt uns zu dem Dorf Raddusch, und dort, wo die Landschaft nur wenig bewaldet ist, sehen wir schon aus der Ferne etwas, was sich auf den ersten Blick nicht einordnen lässt:
Die riesig scheinende kreisrunde Anlage, wirkt stark und mächtig in der ebenen Landschaft, ein Eindruck, der gewollt war, um Feinde zu beeindrucken. Denn es handelt sich hier um die Rekonstruktion einer Burg, wie die im 9. und 10. Jahrhundert hier lebenden Lusizi, ein slawischer Stamm, sie errichteten, um sich gegen die ostwärts drängenden Germanen zu schützen. Bei drohender Gefahr suchten die in der Nähe lebenden Lusizi Schutz in dieser aus Baumstämmen, Steinen und Sand errichteten Burg, die zusätzlich durch einen Wassergraben gesichert war. An die 40 solcher Burganlagen gab es damals.
Leben im Burggraben
Detailansicht der Burg
Dennoch konnten die Lusizi den germanischen Eroberern nicht standhalten, sie wurden besiegt, und ihre Burgen verfielen in den folgenden Jahrhunderten. Otto Eduard Schmidt konnte diesen Abstecher also nicht machen, denn die jetzige Rekonstruktion, die im Inneren ein Museum zur Geschichte der Niederlausitz beherbergt, wurde erst 2003 eröffnet.
Stattdessen reist Herr Schmidt auf der Landstraße nach Burg, „dem Hauptort des oberen Spreewaldes“. Doch er wandert gleich etwas weiter, denn:
„Die größte Sehenswürdigkeit von Burg ist der eine Viertelstunde nordwärts liegende Burgwall, von den Einwohnern meist das Schloß oder der Schloßwall genannt, die uralte Befestigung, die auch dem Dorfe den Namen gegeben hat.“
Archäologische Funde belegen, dass es hier schon in der Steinzeit eine besiedelte Erdburg gab. Später nutzten die Lusizi diesen Ort und errichteten eine solide Burg, ähnlich der, die heute in Raddusch zu sehen ist. Hier soll ein sagenumwobene Wendenkönig gelebt haben.
Wilibald von Schulenburg schreibt:
„Der wendische König (Serski kral) hat auf dem Schloßberge zu Burg gewohnt und war ein Räuber. Er schlug die Hufeisen verkehrt auf, daß niemand wissen sollte, ob er heraus- oder hereingeritten war, und hatte eine lederne Brücke, die sich von selbst aufrollte. Darüber ist er geritten; so konnten sie ihn nicht abfassen, denn damals war alles Sumpf und Wasser. Sein Weg ging immer nach Guhrow (Richtung von Nordwest nach Südost). Er hatte viel Geld, darum ist der Schloßberg verwünscht worden. Zuletzt kam ein Gewitter und erschlug den König, und das Schloß versank. Das kann man noch sehen, denn in der Mitte ist der Schloßberg tief, und stößt man mit einer Stange auf, so klingt es hohl.“
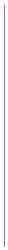
Auf einer Bank sitzend beobachtet Schmidt die Landschaft und erfreut sich an deren „eigentümlichen Reiz“. Während er seinen Blick über die idyllische Natur streifen lässt, fällt ihm Bewegung auf: „Auf den Feldern sind fleißige Spreewälder beschäftigt, das Korn noch in altväterischer Weise mit der Sichel zu schneiden und in „Mandeln“ aufzurichten. […] ein herrliches Bild von homerischer Einfalt und Anmut.“
Eine zwiespältige Sache! Sicherlich kann es dem Touristen niemand verwehren, auch am Anblick der Feldarbeit seine Freude zu haben, sie als Teil seiner Urlaubskulisse zu sehen. Andererseits darf man nicht vergessen, dass es sich hier um eine sehr anstrengende körperliche Arbeit handelt - vor einhundert Jahren noch viel mehr als heute!
Der sächsische Literaturhistoriker und Sagenforscher Johann Georg Theodor Grässe (1814 - 1885) berichtet im zweiten Band seines „Sagenschatz des Königreichs Sachsen“:
„Das Mittagsgespenst (Pschipolnitza) ist ein weibliches, großgewachsenes weißgekleidetes Wesen, welches zur Mittagszeit von 12 bis 2 Uhr auf den Feldern zu erscheinen pflegt. Es schweift mit der Sichel bewaffnet über die Felder und steht unerwartet vor denjenigen, welche es versäumt hatten, Mittags die Feldarbeit zu unterlassen und nach Hause zu gehen. Die Ueberraschten mußten ein scharfes Examen über den Anbau des Flachses und das Leinwandweben bestehen und die ganze Procedur dieses Kulturzweiges ununterbrochen und in einer solchen Ausführlichkeit vortragen, daß damit die Zeit bis zwei Uhr ausgefüllt wurde. Hatte diese Stunde geschlagen, so war es mit der Macht desselben aus und es ging von dannen. Wußten aber die Geängstigten auf ihre Fragen nicht zu antworten und das Gespräch bis zu dieser Stunde nicht im Gange zu erhalten, so schnitt sie ihnen den Kopf ab oder erwürgte sie oder verursachte ihnen wenigstens eine mit Kopfschmerzen verbundene Krankheit. Bei trübem Himmel oder zur Zeit eines herannahenden Gewitters war man vor ihr sicher. Noch jetzt spricht man im Scherz zu demjenigen, welcher während der Mittagszeit ohne Noth auf dem Felde arbeitet: „fürchtest Du nicht, daß die Mittagsfrau auf Dich kommen wird?“ und die sprichwörtliche Redensart: „sie fragt wie die Mittagsfrau“, ist im alltäglichen Gebrauch.“
Diese Sage mag auf der Überanstrengung durch Feldarbeit während der glühendsten Mittagshitze basieren, wenn Mägde und Knechte entweder von ihren Herren zum Arbeiten ohne Pause gezwungen wurden, oder ihr eigenes kleines Eckchen Land bearbeiteten, weil ihnen nur dann die Zeit dafür blieb. Da kam es sicherlich häufig zu Kopfschmerzen oder anderen Erschöpfungssymptomen, im schlimmsten Fall zu Todesfällen durch Sonnenstich, die dann der Mittagsfrau zugeschrieben wurden!
Populär ist diese Sagengestalt bis in unsere Tage, 1991 schaffte sie es sogar auf eine Briefmarke!


Den Rest des Nachmittages verbringt Herr Schmidt gemütlich, denkt über die Spree und ihren sonderbaren Verlauf nach, und besucht einen „jener wendischen Einzelhöfe, die für diese Gegend so bezeichnend sind.“
Zu seiner Zeit hatte der Tourismus im Spreewald bereits eingesetzt. Während Schmidt darüber sinniert, dass er Willibald von Schulenburg zustimmt: „wo noch ein Rest der alten Spinnstuben oder des gemeinsamen Strohflechtens das Zeitalter polizeilicher oder pastoraler Verfolgung überdauert hat, erweist er sich als ein Hort feinerer Gesinnung.“, erzählt ihm der Bauer, dass jedes Jahr etliche „Photographisten“ kämen, um sein malerisch gelegenes Gehöft abzulichten. Viele Städter haben den Spreewald schon als das entdeckt, was wir heute Naherholungsgebiet nennen. Dies zeigt sich auch am Abend, den Schmidt im Gasthof „zur Bleiche“ verbringt. Der Name stammt von der Leinwandbleiche, die den im 18. Jahrhundert hier angesiedelten Webern zur Verfügung stand. Zu Schmidts Zeit geht es dort so zu:
„So saß denn die alte Gaststube der Bleiche voll von schmalschädligen, wendisch aussehenden Fährleuten, draußen aber im Garten und in der Veranda drängten sich elegante Damen und Herren aus Berlin und Dresden und anderen Großstädten.“
Nachdem Schmidt am Sonntagmorgen in Burg den Kirchgang der Spreewälderinnen beobachtet und wieder einmal die farbenfreudigen Trachten bewundert hat, geht es endlich auf zum eigentlichen Highlight der Reise: Einer Kahnfahrt nach Lübbenau.
Die mehrstündige Fahrt führt vorbei an Kaupen, den natürlichen inselartigen Sandablagerungen, auf denen Gehöfte gebaut sind, und die man nur auf dem Wasserwege erreichen kann. Hier sieht man deutlich die besondere, an die Natur angepasste Lebensweise im Spreewald: Nicht Wege und Straßen, sondern die Wasserarme der Spree dienten damals als Verkehrswege, folglich liegen hier die Haustüren - und oft auch die Briefkästen! - zum Wasser hin!
Es geht vorbei am Forsthaus Eiche - dem Gasthof, in dem Fontane seinerzeit einkehrte, um ein „echtes Spreewaldmahl“ einzunehmen, den damals noch reichlich in den hiesigen Fließen vorhandenen Hecht - , und weiter, vorüber an der Kanomühle und der Kaupe Wotschofska.
Dieser Name stammt aus dem Sorbischen „wótšow“ und heißt übersetzt „Insel“. Tief im Innersten des Spreewaldes gelegen und ausschließlich auf dem Wasserweg zu erreichen, diente die Wotschofska früher in Kriegszeiten als Zufluchtsort vor Feinden, die sich nicht in das urwaldähnliche Gewirr aus Wasser, Wald und Morast getrauten.
Als Schmidt an dieser Insel vorbeifährt, steht hier jedoch schon seit einigen Jahren ein Gasthof, und der Spreewaldtourismus ist in vollem Gange:
„Hier erreicht das Getreibe der ankommenden und abfahrenden Boote den Höhepunkt. Sie sind meist von Berlinern besetzt, die der sonntägliche Frühzug nach Lübbenau gebracht hat. Ihre wohlberechtigte Freude darüber, daß sie dem dumpfen Häusermeer einmal entschlüpft sind, paart sich mit dem Bedürfnis, ihre spezifische Intelligenz vor den Nichtberlinern leuchten zu lassen, und so gleicht denn die schmale Wasserstraße zur Wotschofska einer großen Lästerallee, in der man alle Spielarten des Berliner Witzes von einer liebenswürdigen Anzapfung im Vorbeifahren herab bis zur derbsten Schnoddrigkeit ebenso gut studieren kann wie in der Hasenheide.“
Diesen Seitenhieb konnte sich der Sachse offensichtlich nicht verkneifen! Erst 1911 wurde übrigens ein Weg errichtet, auf dem die Insel nun von Lübbenau aus zu Fuß oder per Fahrrad erreicht werden kann - autofrei ist sie noch immer!

Anschließend erreicht Schmidt den „Glanzpunkt der Fahrt, das Dorf Lehde, ein Klein-Venedig ins Urwaldliche übersetzt, wo jedes Haus auf einer Insel liegt, und sogar der Schulweg im Kahn zurückgelegt wird.“
Schon Fontane hatte geschrieben:
„Es ist die Lagunenstadt in Taschenformat, ein Venedig, wie es vor 1500 Jahren gewesen sein mag, als die ersten Fischerfamilien auf seinen Sumpfeilanden Schutz suchten. Man kann nichts Lieblicheres sehn als dieses Lehde, das aus ebenso vielen Inseln besteht, als es Häuser hat.“
Man sieht: Es ist durchaus legitim, die gleiche Ansicht oder Empfindung zu haben, wie andere vor einem, wenn man sie aber etwas unterschiedlich formuliert, kann einem niemand einen Plagiatsvorwurf machen!



Schließlich erreicht der Kahn sein Ziel: „Endlich gleitet das Boot am Parke des Grafen Lynar vorüber in den reich belebten Gondelhafen des Städtchens Lübbenau.“ Hier findet Schmidt sogar noch eine steinerne Erinnerung an die Zeit, als dieses Gebiet kursächsisch war, eine Postsäule aus dem Jahr 1740, auf der unter anderem die Entfernung nach Dippoldiswalde mit 28 Stunden angegeben ist. Für Interessierte: Diese Postsäule steht noch immer. Und im Hafen von Lübbenau kann man auch heute gemütlich sitzend das bunte Treiben beobachten.
Hier endet das Kapitel über den Spreewald. Natürlich gibt es noch etliche weitere sehenswerte Ortschaften, historische Bauwerke und vor allem jede Menge Natur zu entdecken, aber wir beenden hier die Tour mit Otto Eduard Schmidt.
Weitere ausführliche Geschichten aus der Geschichte des Spreewaldes finden Sie in diesem Buch.
Theodor Storm
Schleuse im Spreewald mit Anleitung zur Handhabung
Blick in den Park am Schloss Lynar
Das Schloss der Grafen zu Lynar
Schlosspark in Lübbenau
Schloss Lynar in Lübbenau
Salweide
Auf in den
Erhältlich im Buchhandel und
direkt beim Tauchaer Verlag